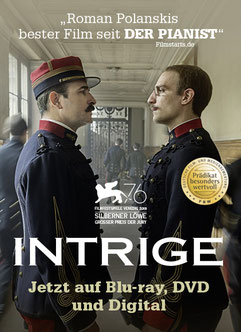Anzeige
DIE BRÜCKE
eine wahre geschichte

Der Schnee kam früh in jenem November und wie die Flocken leise, aber stetig alles bedeckten, breitete sich die Sorge aus bei den jüdischen Bewohnern von Gailingen. Sie suchten moralische und religiöse Unterstützung bei ihrem Rabbiner, Dr. Markus Bohrer, diesem noch jungen Geistlichen und Lehrer, der erst fünf Jahre zuvor sein Amt in der orthodoxen Gemeinde Gailingen-Randegg am Hochrhein angetreten hatte. Streng religiös und rabbinischer Nachfolge des würdigen Jakob Löwenstein s. A. und seines Sohnes, des würdigen Leopold Löwenstein s. A., suchte Markus Bohrer auch unkonventionelle Wege, um die ihm anvertrauten Juden zu trösten und zu zerstreuen. Den zunächst vereinzelten, dann anhaltenden, schließlich sich ausbreitenden Schikanen, Ausgrenzungen und Demütigungen begegnete Dr. Bohrer mit Zuversicht und beschwor die Gerechtigkeit G‘ttes. Auch war ihm stets daran gelegen, kleine Freuden zu schaffen, denn Freude ist wohlgefällig. Eines der Bilder aus diesen Tagen zeigt den 32-jährigen beim Schlittenfahren mit fünf jüdischen Jugendlichen. Man sieht einen schmalen Mann, förmlich gekleidet auch auf dem Schlitten, und Kinder, die lächelnd, aber ohne jeden Übermut in die Kamera blicken.
Das Gebet, die kleinen Ausflüge, die freundlichen Worte, die Rabbiner Bohrer „seinen“ Juden anbot, erbosten die örtlichen NS-Leute und die Sticheleien und Verbote, die Rempeleien und die Vorladungen – gerne am Shabbat! – nahmen zu, nahmen überhand. Der Rabbiner, ein Nachkomme der berühmten deutsch-polnischen Rabbinerfamilie Rappaport, weit gereist, im Besitz traditioneller und modern-weltlicher Lehre und sogar als Philosoph in Berlin ausgebildet, schuf in jener Zeit auch Räume des inneren Rückzuges. In diese einzubrechen wäre es besonders den primitiven Nazi-Emporkömmlingen lange Zeit nicht gelungen, jedoch…
…jedoch waren da acht Kinder, die die Rebbezen ihm zur Welt gebracht hatte. Und mochte Markus auch Geistlicher und Lehrer und Philosoph sein – weltfremd war er nicht. Immer wenn er die kleine Ruth sah, 1933 geboren, oder Tessi, mit der die Rebbezen schwanger ging, wenige Wochen nach Ruths Geburt oder gar, wenn die zweijährige Chana sein Bein umklammerte, wandte er sich an HaShem: „Mach, dass die Kleinen, die Du uns gesandt hast in dieser Zeit der Ängste, den Frieden Deiner Welt kennenlernen.“ Und so hatte Rabbiner Markus, der Palästina nur ein einziges Mal bereiste, längst Ausreisepapiere für die Seinen beantragt – Dokumente, die seine Frau Scheine, die Kinder und ihn über England nach Palästina führen sollten.
Hätte er schweigen sollen, der Rabbiner? Konnte er den Verunsicherten, Verängstigten, Verzweifelten das Wort verwehren und gleichzeitig seine Ausreise vorbereiten? Er half, wo er konnte.

Sie kamen aus der Kaserne Radolfzell und nachdem sie in Konstanz alles zerstört hatten, was an „den Juden“ erinnern könnte, nachdem sie ihre Schergen vor den jüdischen Geschäften am See postiert und die bösartige Warnung „Kauft nicht beim Juden“ in der Stadt verbreitet hatten, zogen sie in der Nacht vom 9. auf den 10. November nach Gailingen, dem zweitgrößten „Judenort“ im Kreis.
Als morgens um 5 Uhr grobe Fäuste die Tür einschlugen, als das ächzende Holz unter einem letzten Fußtritt splitterte, wusste Dr. Bohrer, dass die schrecklichste Stunde geschlagen hatte. Sie rissen ihn aus dem Bett, durchwühlten das Rabbinatszimmer, und zerschlugen, entweihten und verbrannten die Inneneinrichtung der Synagoge, die unmittelbar vor dem Haus der Rabbinerfamilie lag. Die führenden Männer der Jüdischen Gemeinde wurden in das 200 Meter entfernte Rathaus getrieben und dort im Keller jenen Torturen, Misshandlungen und Qualen ausgesetzt, die den Menschen auch dann zerstören, wenn er das Unglück hat, solches zu überleben.
Das passierte zwischen 9 und 10 Uhr nach jenem Novembertag, dessen nationalsozialistische Bezeichnung von so manchem Zeitgenossen, sagen wir: unbedacht – noch immer genutzt wird. Reichskristallnacht. Es war der Tag nach dem Novemberpogrom.
Gegen 10 Uhr brüllten die SA-Leute alle Juden – alle! Kranke, Alte, Gebrechliche, Kinder – in der Turnhalle zusammen. Niemand wusste, was geschah. Sie warteten: zitternd, verstört, betend, und der, auf dessen Beistand sie immer hatten zählen können, war zu helfen nicht in der Lage: er lag mit zerschundenen Gliedern, immer wieder das Bewusstsein verlierend auf dem steinigen Kellerboden des Rathauses.
Von der Turnhalle trieben die SA-Leute die Juden zur Synagoge, zu der brennenden Ruine. Der Zug der Juden war lang und langsam, die Straßen menschenleer. Deshalb hat niemand etwas gesehen, richtig? Alle haben gesehen. Alle – hinter den leise sich bewegenden Vorhängen, durch den schmalen Spalt eines fast geschlossenen Tores, aus den Fenstern eines – natürlich! – arischen Geschäftes – jeder sah den Zug. Am Synagogenplatz verkündete man den jüdischen Kaufleuten und Lehrern und Ärzten und Bettlern und Kindern und Alten, dass sie aus dieser Stadt zu verschwinden hatten.
Der Rabbiner aber und seine Mitstreiter, deren Autorität in der Gemeinde von den Nazis fraglos anerkannt wurde – hätte man sie sonst einer Sonderbehandlung unterzogen? – wurden nach Dachau verbracht.
„Karte, Geld vom 22. dankend erhalten. Bin gesund, dies sehnlichst von Dir und den geliebten Kinderchen erhoffend“, schrieb Dr. Bohrer aus Dachau und er schrieb von den Auswanderungspapieren, die jeden Moment eintreffen mussten. Und er hoffte auf seine Entlassung.
Am 28. November endlich war sein Name im Verzeichnis jener, die nach Hause geschickt werden sollten. In Vorbereitung hatten sie sich aufzustellen, im Freien, nackt, stundenlang. Der zarte Mann mit den im Keller des Rathauses in Gailingen geschlagenen, misshandelten Gliedern verlor das Bewusstsein. Auf der Krankenstation, in die ihn zu bringen sich endlich jemand erbarmte, hatte er noch 24 Stunden zu leben. Rabbiner Markus Bohrer starb am 30. Dezember 1938.
Wenige Stunden zuvor waren in der notdürftig in Ordnung gebrachten Rabbinerwohnung die Ausreisepapiere für die ganze Familie angekommen.
Batschewa Jenny Laks, Witwe und Rebbezen, von ihrem zu Tode gequälten, ermordeten Mann liebevoll „Scheine“ genannt, wollte eines nicht: ihren Kindern, besonders den Kleinen, die Hoffnung nehmen, die sich mit dem Wunder von Chanukka verbindet. Und so zündete sie Kerze um Kerze der Channukia und das Öl ging nicht aus.
Am 19. Januar 1939 verließ Scheine mit Maier und Dov und Amalie und Leo und Berta und Ruth und Tessi Gailingen. In wenigen Schritten erreichten sie die hölzerne überdachte Brücke, die das Wahrzeichen des deutschen Städtchens Gailingen ist. Es gelang ihnen diese zu überqueren und Diessenhofen, die kleine Stadt am Schweizer Ufer des Rheins zu erreichen. Ich stelle mir das so vor: Es war schon dunkel, als die Mutter ihre Wohnung verließ und die Kinder hielten einander an der Hand. Nein, nicht das Kleinste ganz hinten. Jenny hielt die Hand des jüngsten Kindes in der kleinen Menschenkette, an deren Ende der 14-jährige Maier schon all seine künftige Verantwortung für die Familie empfand. Die beiden ältesten Brüder ihre Finger fest ineinander verschränkt.
Sie betraten die hölzerne Brücke. Nach 89,2 Metern waren sie gerettet.
Claudia Korenke. (Die Autorin ist Vizepräsidentin der Deutsch-Israelischen Gesellschaft)